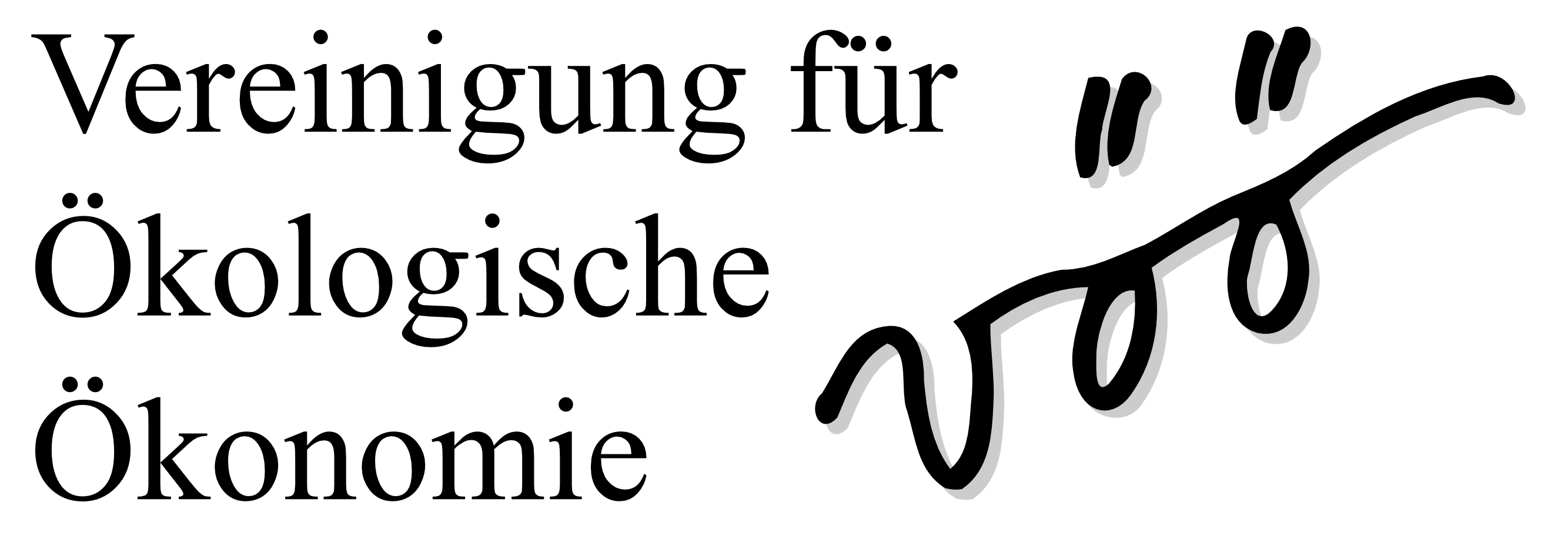Dr. Matthias Schmelzer: The hegemony of growth: The making and remaking of the economic growth paradigm and the OECD, 1948–1974
Die Dominanz des Wachstumsgebots ist kaum zu übersehen. Es erscheint auf den Titelseiten der Zeitungen, spielt eine Schlüsselrolle in ökonomischen Analysen, und durchzieht politische Debatten, sowohl über Ländergrenzen als auch das politische Spektrum hinweg. Diese Priorität des Wirtschaftswachstums – die der Umwelthistoriker John McNeill als die „wichtigste Idee des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet hat – ist jedoch ausgesprochen erklärungsbedürftig. Und zwar nicht zuletzt vor dem Hintergrund von Klimawandel, Ressourcenknappheit, und den Ergebnissen der Wohlfahrts-, feministischen und ökologischen Ökonomie.
Vor diesem Hintergrund ist das Ziel dieser wirtschaftshistorischen Dissertation, die allumfassende Priorität des Wirtschaftswachstums in ihrer historischen Genese zu analysieren. Denn wie auch für die Entstehung der Post-Development Diskussion in den 1990er Jahren die historische Dekonstruktion der Entwicklungsidee entscheidende Voraussetzung darstellte, so ist ein grundlegendes Verständnis der historischen, politischen und sozialen Grundlagen des Wachstumsparadigmas entscheidend, um eine Wirtschaft ohne Wachstum zu denken und gesellschaftlich zu erkämpfen. Interessanterweise liegen zu diesem Thema bisher fast keine historische Arbeiten vor und keine einzige Studie, in der die internationale Dimension des Wachstumsparadigmas thematisiert wird. Ich gehe der Frage nach, wie es in der 2. Hälfte des 20. Jh. dazu gekommen ist, dass Wirtschaftswachstum fast universell als ein selbst-evidentes Ziel von Wirtschaftspolitik gilt und wie diese Selbstevidenz kontinuierlich reproduziert wurde in sich verändernden Kontexten. Was waren zugrundeliegende Annahmen, wie und von welchen Interessenkonstellationen wurde Wachstum gerechtfertigt, wie wurde es in Frage gestellt, und was waren jeweils zentrale historischen Dynamiken, Kontinuitäten und Brüche?
Um diese Fragen zu beantworten, habe ich die Produktion von ökonomischer Expertise zu Wirtschaftswachstum innerhalb der OECD und ihre Vorgängerorganisation, dem Europäischen Wirtschaftsrat (OEEC) untersucht. Die OECD stellt nicht nur eine exemplarische und besonders aussagekräftige Beobachtungsplattform dar, um das ‚making and remaking’ des Wachstumsparadigmas in seiner transnationalen Dimension zu analysieren, sondern sie war auch einer der wichtigsten Akteure bei dessen Durchsetzung. Die Untersuchung erstreckt sich dabei vom Aufkommen der Wachstumsidee über dessen ideologische Krise in den späten 1960er Jahren, bis hin zur Rehabilitierung des Wachstumsparadigmas im Kontext der Weltwirtschaftskrise 1973/74.
Als Wachstumsparadigma analysiere ich die Vorstellung, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit all den in diesen statistischen Standard eingeschriebenen Annahmen, Reduktionen und Ausschlüssen adäquat wirtschaftliche Aktivität misst; dass Wachstum ein wichtiges Allheilmittel für eine Vielzahl von (sich immer wieder wandelnden) gesellschaftlichen Herausforderungen ist; dass Wachstum praktisch unendlich ist, vorausgesetzt die richtigen (inter)nationalen Politiken werden verfolgt; und schließlich, dass Wachstum einen universeller Maßstab für einige der grundlegendsten gesellschaftlichen Ziele wie Fortschritt, Wohlfahrt und nationale Macht darstellt.
Die vier wichtigsten Ergebnisse sind die folgenden:
Ausschlaggebend für die globale Durchsetzung des BIP als Maßeinheit für wirtschaftliche Aktivität war nicht ein wissenschaftlicher Konsens – im Gegenteil: Entscheidend war vor allem die politische Nachfrage nach vergleichbaren Zahlen durch internationale Organisationen und Regierungen. Inter- essanterweise sprachen sich in der Mitte des 20. Jahrhunderts fast alle führenden Ökonomen_innen dagegen aus, das BIP als Maßstab für den Wohlstand der Nationen und für internationale Vergleiche zu nutzen. Und es gab eine Vielzahl an konzeptuellen Divergenzen zwischen nationalen Traditionen sowie fundamentale innerwissenschaftliche Kontroversen zu dieser Messmethode – Stichworte dieser Diskussion sind Externalitäten, unbezahlte Hausarbeit, und Subsistenz. Dass sich in den frühen 1950er Jahren trotzdem die Sicht durchsetzte, dass dieser Standard ganz generell wirtschaftliche Aktivitäten richtig misst und über Raum und Zeit vergleichbar macht, lag vor allem an seiner politischen Nützlichkeit. Entscheidend war die internationale Standardisierung der Wirtschaftsstatistiken, bei der sich die OEEC, wie ich erstmals zeigen konnte, unter angelsächsischer Führung zum globalen Trendsetter entwickelte. Durch diese Standardisierung entstand überhaupt erst eine einheitliche Konzeption von ‚der Wirtschaft’ und eine international homogenisierte Lingua Franca, auf die sich Regierungen, internationale Organisationen und die sich globalisierende Wirtschaftswissenschaft bezog. In diesem Prozess wurden die konzeptuellen Probleme zunehmend in den Hintergrund gedrängt und unsichtbar gemacht (‚black-boxing’). Der gescheiterte Versuch innerhalb der OECD, in den 1970er Jahren Sozialindikatoren als Alternative zum BIP zu entwickeln, verdeutlicht die enormen Schwierigkeiten, diese ‚mächtigste Zahl der Welt’ zu verändern.
Zweitens argumentiere ich, dass Wachstum in den frühen 1960er Jahren zu dem universellen Maßstab für einige der grundlegendsten gesellschaftlichen Ziele wurde. Trotz ihres technokratischen Nimbus wurden Wachstumsstatistiken in politischen Diskussionen zunehmend mit einer Vielzahl an facettenreichen Bedeutungen aufgeladen. Dabei wurden so unterschiedliche gesellschaftliche Ziele wie Prosperität und Lebensstandard, Modernität und Entwicklung, aber auch das Prestige von Ländern zunehmend maßgeblich in Relation zum BIP bewertet. Und fast noch entscheidender: Die Veränderungen dieser Statistik spielten eine Schlüsselrolle dabei, Erfolg oder Scheitern von Regierungen zu beurteilen, den relativen Status von Ländern oder Machtblöcken zu bestimmen und bei der Formulierung und Bewertung einer Vielzahl von politischen Maßnahmen.
In der dritten These schlage ich eine Neubewertung in Bezug auf die Auswirkung der Weltwirtschafts- und Ölkrise von 1973/74 vor: Anders als oft angenommen verstärkte diese nicht die sozial-ökologische Skepsis gegenüber dem BIP-Wachstum, die in den späten 1960er Jahren immer populärer geworden war. Vielmehr wirkten Arbeitslosigkeit, Rezession, und Energieknappheit als Katalysator für einen erneuten Fokus auf Wachstum, der die Diskussionen über Qualität, Wohlfahrt und sozial-ökologische Folgekosten des Wachstums in den Hintergrund drängte. Interessanterweise war es gerade die OECD gewesen – also die Organisation, die damals als „temple of growth for industrialized countries“ schlechthin galt – die sich ab 1967 zum globalen Vorreiter der Kritik am quantitativen Wirtschaftswachstum entwickelt hatte. Diese Kritik wurde vor allem durch eine Gruppe von OECD-Expert_innen um das Wissenschaftsdirektorat vorangetrieben. Diese, so das vielleicht überraschendste Ergebnis der Dissertation, war die entscheidende Triebkraft hinter der Gründung des Club of Rome und prägte diesen in den ersten Jahren entscheidend.
Viertens argumentiere ich, dass der Aufstieg ökonomischer Experten_innen in einflussreiche Regierungsämter und der Ökonomie zur gesellschaftlichen Leitwissenschaft aufs engste mit dem Aufkommen des Wachstumsparadigmas in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verwoben war. Im Kontext der Verwissenschaftlichung des Sozialen verstärkten sich beide Entwicklungen gegensei- tig. Die Möglichkeit, Wachstum zu messen und politisch zu steuern stattete Ökonom_innen mit einem Set an Fähigkeiten und Instrumenten aus, das sie zunehmend unentbehrlich für das Regieren von Gesellschaften machte, die Wachstumssteigerung anstrebten. Gleichzeitig verstärkte der Aufstieg ökonomischen Wissens als politischer Rechtfertigungsdiskurs das Wachstumsparadigma und führte zu einer Ausbreitung des Wachstumsziels in nicht-ökonomischen Politikbereichen.
Zusammenfassend vertrete ich die These, dass das Streben nach Wachstum und die diesem zugrundeliegende Expertise weder neutrale analytische Kategorien sind noch einfach als gegeben und schon immer existierend angenommen werden können (und zwar obwohl vor allem ersteres in der ökonomischen und wirtschaftshistorischen Forschung oft geschieht). Vielmehr sind die Idee, dass Wachstum ein zentrales gesellschaftliches Ziel sein sollte, sowie die Techniken dies zu messen, zu model- lieren und politisch zu steuern, historisch gesehen recht jung und haben eine komplexe, politisch umstrittene und von Brüchen geprägte Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte. Sie spielen als Schlüsselelemente gesellschaftlicher Hegemonie eine zentrale Rolle bei der Stabilisierung kapitalistischer Gesellschaften.